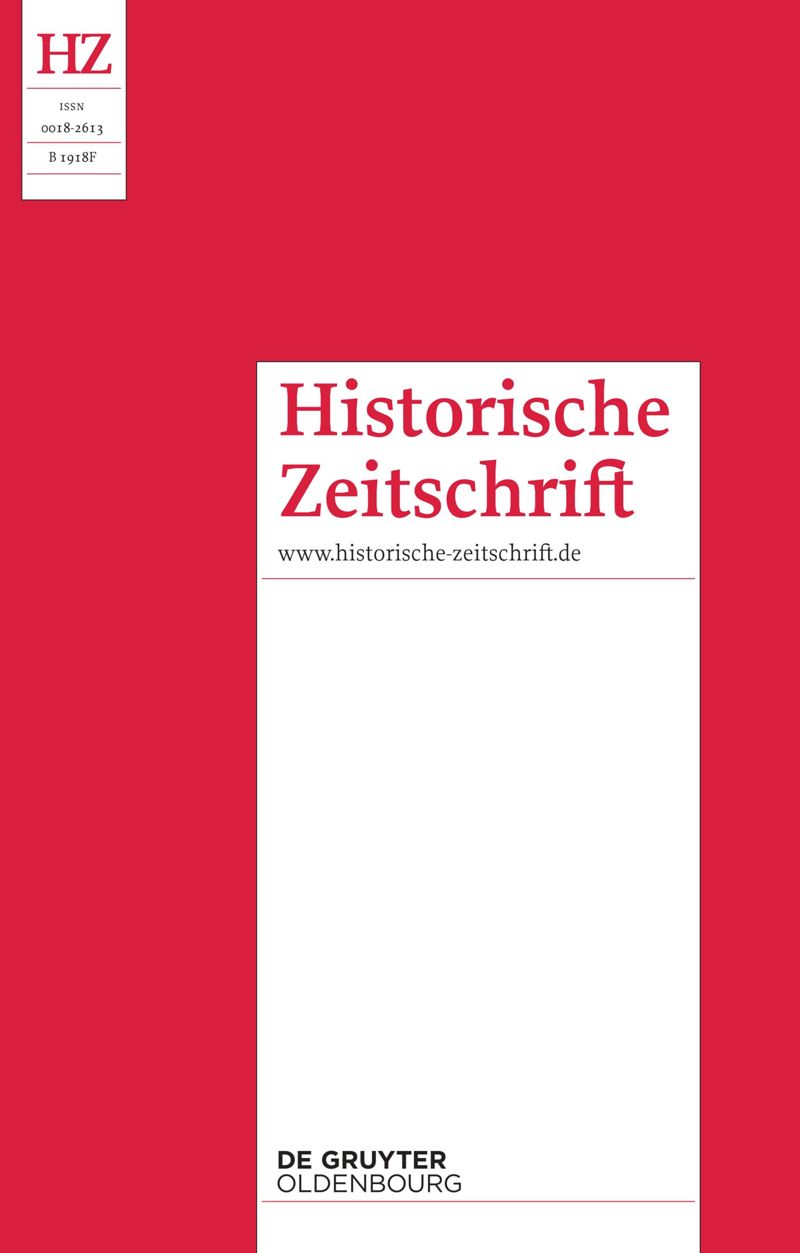Qui tam pro domino rege quam pro se ipso. Über die Herrschaftswirkungen privater Strafverfolgung (common informing) im frühneuzeitlichen England
Hannes Ziegler
01.10.2022
Hannes Ziegler, Qui tam pro domino rege quam pro se ipso. Über die Herrschaftswirkungen privater Strafverfolgung (common informing) im frühneuzeitlichen England, Historische Zeitschrift 315 (2022), 289–318.
Abstract: Die Durchsetzung herrschaftlicher Gesetzgebung erfolgte im frühneuzeitlichen England in hohem Maße über den Rechtsgrundsatz qui tam und die damit verbundene Technik des common informing: Die private Anklage und Strafverfolgung ökonomischer, sozialer, religiöser und politischer Devianz wurde finanziell belohnt. Vom Rechtsverstoß persönlich unberührte Personen wurden auf diesem Weg zu Sachwaltern des Gemeinwohls mit exekutiven Befugnissen, denn alle Rechtsentscheide waren auch für die Krone bindend. Rechtshistorikern wohlbekannt, ist diese dem common law eigene Form der Strafverfolgung hinsichtlich ihrer Herrschaftswirkungen bislang unbeachtet geblieben und in ihrer politischen und sozialen Dimension wenig erforscht. Hier verspricht sie jedoch neue Erkenntnisse: Unter Verzicht auf einen entsprechenden Amtsapparat delegierten Herrschaftsträger die Ausübung obrigkeitlichen Zwangs erfolgreich an die Untertanen, eröffneten diesen jedoch unfreiwillig Zugang zu Herrschaftsrechten. Entsprechend erlaubten Formen des informing für einzelne Untertanengruppen zahlreiche Partizipationsmöglichkeiten, führten allerdings durch ihren denunziativen Charakter zugleich zu einer Verschärfung sozialer Antagonismen und zu neuen vertikalen Abhängigkeiten. Über informing hergestellte und geregelte Herrschaftsbeziehungen waren folglich für beide Seiten ambivalent und verweisen auf strukturelle Dilemmata auch moderner Staatlichkeit. Ziel des Beitrages ist es, common informing im Kontext der Debatte um frühneuzeitliche Staatsbildung und in der Diskussion um englische Staatlichkeit in der Vormoderne zu verorten. Zugleich werden konzeptionelle Vorschläge zu einer Erforschung von informing wie auch zu einer Weiterführung der genannten Diskussionen entwickelt.
Abstract: The enforcement of penal statutes in early modern England was frequently achieved via the legal principle of qui tam and the practice of common informing: the private prosecution of economic, social, religious, and political deviance was financially rewarded. Persons otherwise unaffected by the statutory violation thus became advocates of the common good with executive capacities, for all legal decisions were binding even for the Crown. Well-known among legal historians, this form of common law prosecution has rarely been studied with regard to its implications for early modern authority and remains little explored in its political and social dimension. Here, however, it promises new insights: circumventing the necessity for expensive administrative institutions, governments were able to delegate the enforcement of authority to their subjects. The latter, however, were thereby enabled to encroach on government prerogatives. Accordingly, some of the subjects’ opportunities for participation increased. Because of its denunciatory character, informing also led to a rise in social tensions and new vertical dependencies. Relations between subjects and rulers formed and regulated by informing were thus highly ambiguous for both sides and highlight structural tensions still prevalent in modern politics. It is the aim of this article to locate common informing in the context of the debate about early modern state-building as well as in the discussion about the nature of authority in early modern England. At the same time, the article formulates suggestions both for a better understanding of informing and for a conceptual revision of these debates.
Further information about the publication can be found here.